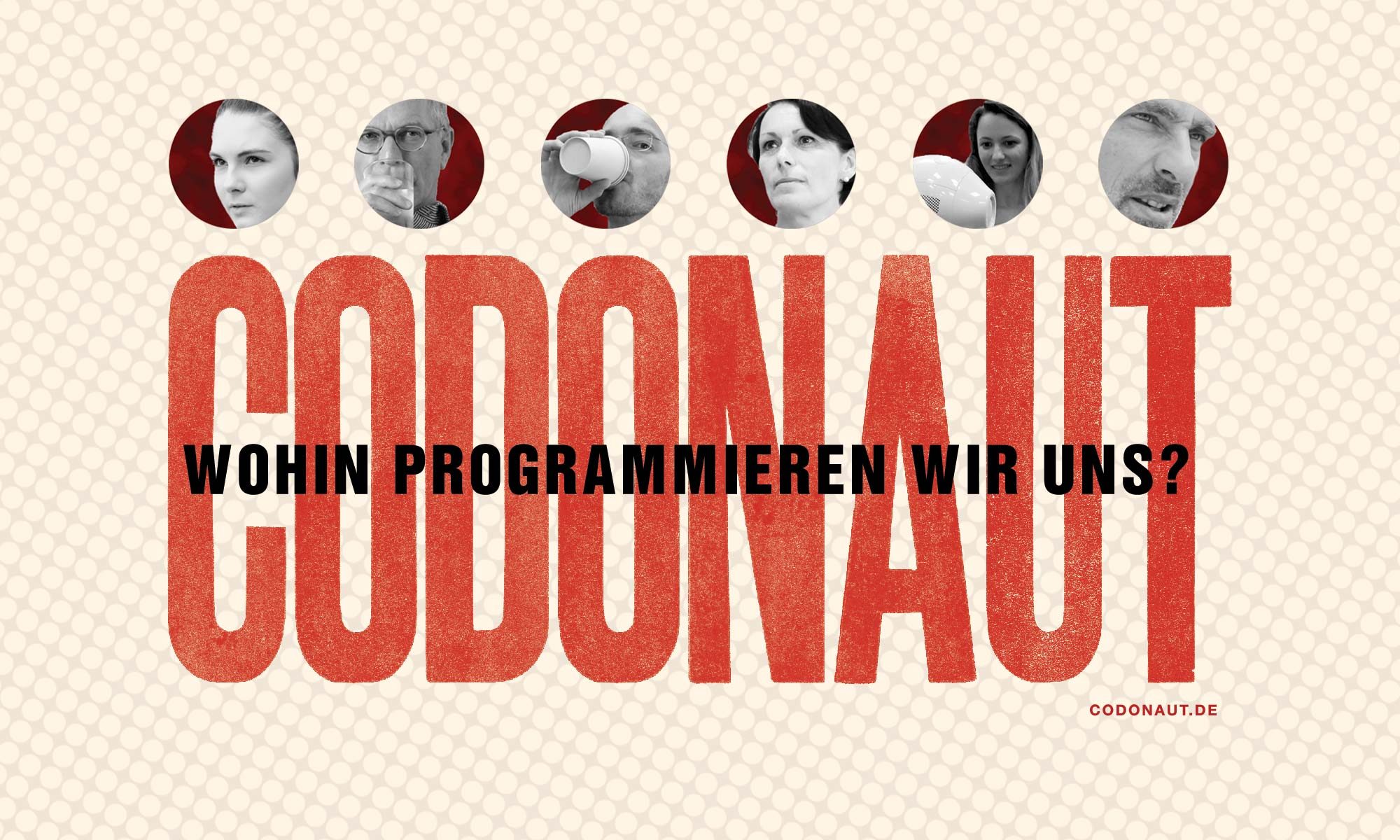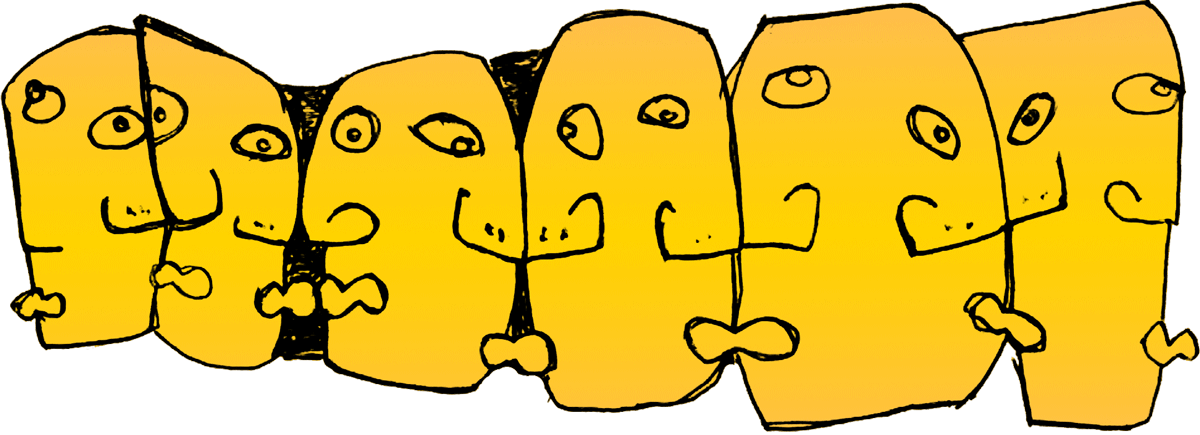Key learnings:
– Mit jedem Interview verringert sich die Vorbereitungszeit
– Spätere Interviews werden besser – also, die Wichtigsten auf den Schluss setzen
– Unbedingt enge Zeitpläne vermeiden
Ich bin als Journalist von herausfordernden Timelines sozialisiert. Die meiste Zeit habe ich im Liveradio gearbeitet. Da nähert sich der Redaktionsschluss sekundengenau, und zwar mehrmals täglich.

Selbst während meines Zeitungsvolontariats war es ähnlich. Wir hatten zwar nur zweimal Redaktionsschluss in der Woche, allerdings auch einen sehr großen Workload zu erledigen. Da blieb kaum Zeit für etwas, das im Qualitätsjournalismus eigentlich ein wahnsinnig wichtiger Arbeitsschritt ist: das Durchatmen und Reflektieren.
Langsamer interviewen – ein Changeprozess, der sich gut anfühlt
Im typischen Zeitdruck gewöhnte ich mir sehr schnell an, Interviews zeiteffizient zu führen. Das bedeutet: in Vorbereitung mäßig investieren, die Interviewfragen idealerweise möglichst genau antizipieren, in der Interviewführung dann stringent der zentralen Aussage oder dem zentralen Ziel folgen, das man vorher definiert hat.
Das reduziert den Aufwand der Nachbearbeitung massiv. Das ideale Endergbnis war ein Interview, das man eigentlich nur vorn und hinten abschneiden musste – und dann war es sendefähig im Formatradio (das meint hier: mit einer definierten Maximallänge). Alle Fortbildungsmaßnahmen und Feedbackprozesse waren darauf angelegt, diesen Prozess weiter zu optimieren.
Es kamen trotz allem immer mal wieder gute, hörens- oder lesenswerte Interviews dabei heraus. Man hat es ja gelernt. Nur eins waren diese Interviews eigentlich nie: überraschend.
Während der Interviews, die wir für Codonaut führten, konnten ich diese Effizienzprägung langsam ablegen – auch dank des Einflusses von Florian und Felix, die Gespräche schon immer aus einer deutlich weniger ressourcenschonenden Sichtweise führen.
Mehr Authentizität, mehr Zusammenhänge, überraschende Wendungen
Das interaktive Format des Codonauten hat eigentlich keine Längenbegrenzung. Inhalt ist immer dann wichtig, wenn er zu Sinn und Erkenntnis beiträgt oder schlicht und ergreifend die User Experience positiv stützt (zum Beispiel auch durch Aspekte wie Spaß oder Neugierde). Einen Schnitt oder ein Weglassen wegen der Länge gibt es nicht.
Oder anders gesagt: form follows content (in Anlehnung an das form follows function – mantra im Produktdesign) – und nicht, wie es ansonsten im (auch digitalen) Journalismus üblich ist: content fills form. Damit ist die interaktive Darstellungsweise eine der wenigen, die sich überhaupt nachhaltig mit dem digitalen Mindset, der digitalen Nutzungserwartung (der UX) heutiger Konsumenten verträgt.
Diese Zeitoffenheit führte während der Interviews immer wieder zu überraschenden Einblicken. Unsere Interviewpartner erzählten irgendwann auch sehr Persönliches. Diese Teile der Interviews verraten viel darüber, warum die Protagonistin oder der Protagonist diese oder jene Einstellung zum Thema entwickelt.
So war es zum Beispiel schon fast klischeehaft (aber sehr amüsierend), wie der Roboterexperte seine Küche zuhause organisiert. Anders Beispiel: die C-Level Managerin eines großen deutschen Konzerns, die anhand ihres schwer erkrankten Vaters erkannt hat, wo es für sie Grenzen in der Nutzung künstlicher Intelligenz gibt (oder eben auch nicht, weil es eigentlich nur irrationale Ängste sind). – ich will hier keine Spoiler veröffentlichen, deshalb: mehr davon im Codonauten.
Diese persönlichen Einblicke stützen die Authentizität der Protagonisten und damit des gesamten Produktes.
Gleichzeitig ermöglicht das Gespräch ohne Zeitdruck erst die Herausarbeitung von Zusammenhängen, die für die Darstellungsform des Codonauten ein wesentlicher Bestandteil sind (denn die einfache Erzähl-KI folgt den Zusammenhängen über mehrere Protagonisten oder Inhaltsstücke hinweg).
Erst das Bilden von vorher nicht erahnten Zusammenhängen, die multiperspektivische Sichtweise auf den Inhalt und schließlich das Begreifen der Komplexität des Systems, von dem berichtet wird, macht meiner Ansicht nach das intensive Nutzungserleben der interaktiven Erzählform des Codonauten aus.
Man muss allerdings in der Produktionsplanung sehr viel mehr Zeit für das Gespräch und die Postproduction berücksichtigen, als ich es vorher gewohnt war. 45 Minuten Gespräch ist zum Teil schon zu wenig. Einige der Gespräche, die wir geführt haben, waren nahezu doppelt so lang. Das vervielfacht natürlich die Nachberarbeitungszeit.
Aber für das Endergebnis ist es das Wert.